- Tests
- Sinking Island - Mord im Paradies
Test
14.10.2007
Mit Syberia konnte der Comiczeichner Benoît Sokal eine Menge Fans in der Adventure-Community gewinnen. Zwar sind Sokals Werke nicht gerade der Inbegriff der spielerischen Haute Cuisine, Kunstwerke auf ihre ganz eigene Art sind sie aber zweifellos. Das liegt natürlich nicht nur an Sokal, sondern auch an den vielen Entwicklern, die seine Ideen und Konzepte in Adventureform gießen. Motive und Stil des Zeichners ziehen sich aber unverkennbar durch alle Abenteuer, die seinen Namen tragen.
Das ersten Spiel seiner Firma White Birds Productions, Paradise, konnte die hohe Qualität aber nicht aufrecht erhalten. Technische Macken und fragwürdige Gameplay-Entscheidungen zogen den Titel hinab in die Mittelmäßigkeit. Trotz der feinen Optik und der großen Ambitionen war es offensichtlich, dass weniger Geld zur Verfügung stand, und so wurde Paradise auch kommerziell zum Flop.
Jetzt soll alles anders werden. White Birds Productions hat mit Sinking Island sein zweites Adventure auf den Markt gebracht. Das unterscheidet sich in einigen Punkten von der Abenteuersafari durch das Herz Afrikas, in anderen Punkten aber auch wieder nicht.
Mörderhatz im Paradies
Endloser Urwald, groteske Fabelwesen, eine verträumte Heldin auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens - all das gibt es im neuen Sokal nicht. Vielmehr tischt der Designer seinen Spielern ein handfestes Whodunnit auf, ein Mord, eine gewisse Menge an Verdächtigen und ein markiger Ermittler, der den Fall lösen muss. Also das genaue Gegenteil der bisherigen Sokals? Nicht ganz. Das Setting ist nämlich nach wie vor höchst ungewöhnlich, der Stil immer noch unverkennbar.
Als abgebrühter Inspektor Jack Norm wird der Spieler zu Beginn des Spiels auf die abgelegene Malediven-Insel Sagorah Island geflogen. Statt Sommer, Sonne und sexy Strandschönheiten wartet dort aber nicht nur Sauwetter auf den Pariser Polizisten, sondern auch eine höchst groteske Situation. Der querschnittsgelähmte Milliardär Walter Jones hatte die abgelegene Insel gekauft, um sie zu einem exklusiven Urlaubsresort nach seinem Geschmack umzufunktionieren. Dazu ließ er mitten auf das bescheidene Eiland einen gewaltigen Turm im feinsten Art Déco bauen, der mit all dem polierten Marmor, den wertvollen Kunstwerken und mit seinen verschwenderischen Ausmaßen perfekter Ausdruck für den Größenwahn des alten Herrn ist.
Noch vor der Eröffnung - einige Stockwerke warten noch auf ihre Fertigstellung - hatte Jones seine drei Enkel und deren Partner auf die Insel eingeladen. Das Treffen war allerdings nicht die herzliche Familienrunde, die man vielleicht erwarten könnte. Im Gegenteil: Es endete mit dem Tod des reichen Gastgebers, der offenbar eine Klippe heruntergestürzt war. Nach dem Eintreffen von Jack Norm ist schnell klar, dass hier kein Unfall passiert ist. Ein Mord war geschehen. Als Täter kommt nur einer der 10 Personen in Frage, die sich zum Tatzeitpunkt auf der Insel befanden. Neben den Enkeln und ihren Partnern wären das der Architekt des Turms, Walter Jones' Anwalt, ein auf der Insel verbliebener Einheimischer und dessen stumme Tochter.
Der Fall entpuppt sich als deutlich komplizierter, als es zunächst den Anschein hat. Immer wieder kommen Geheimnisse ans Licht, überraschende Dokumente werden gefunden und irgendwann hat so gut wie jeder Anwesende ein plausibles Motiv. Die Harmonie in der Familie Jones war schwer gestört und je länger der Sturm über Sagorah tobt, desto mehr Leichen im Keller fördert Jack Norm ans Tageslicht. So kommt es auch, dass der Hauptverdächtige in dem geschickt konstruierten Verwirrspiel nicht nur einmal wechselt.
Ein echter Sokal
Eine einfache, vom Unwetter geschundene Insel mit einem skurrilen Geschwür in Form des zentralen Art-Déco-Monsters wäre allerdings noch nicht unwirklich genug für einen echten Sokal. Das Setting von Sinking Island hat noch die gewisse Prise Fantastik, die bereits der Titel andeutet: Sagorah Island versinkt im Meer. Das zarte Stück Land verkraftet die Kombination aus Mistwetter und Riesenturm nicht und geht Stück für Stück im Ozean unter. Während zu Beginn des Spiels noch der Strand untersucht werden kann, steigt das Wasser später bis in die Hotellobby und zwingt Jack Norm dazu, seine Ermittlungen auf das Innenleben des Turms zu beschränken. Während unten immer mehr Locations wegfallen, kommen dafür in höheren Ebenen immer mehr Räume dazu, die man betreten kann.
Die Vielfalt der Charaktere ist groß. Jede einzelne Figur hat seine ganz bestimmte Rolle in dem Konstrukt des Mordfalls, sodass niemand eine austauschbare Strohpuppe bleibt. Die individuellen Charakterzüge arbeitet das Spiel schön heraus.
Als Geschichte kann Sinking Island also voll überzeugen. Bis zum Schluss bleibt der Fall spannend. Die deutschen Texte sind gut geschrieben, auch wenn sich hier und da mal ein Fauxpas ("legale Schritte") eingeschlichen hat. Dafür sind die zahlreichen grafischen Dokumente ebenfalls ins Deutsche übertragen worden. Der markanten Jugendstil-Schriftart, die für kurze Einblendungen im Spiel genutzt wird, fehlen leider die Umlaute ("Ratsel gelost"), der Schrifttyp der weitgehend fehlerfreien Untertitel hat dieses Problem allerdings nicht.
Wo ist das Spiel?
Doch wie schlägt sich Sinking Island als Spiel? Leider nicht so gut.
Die Spielwelt ist noch dünner als in Paradise oder Syberia. Jack Norm rennt immer wieder durch etliche Bildschirme, die außer den Ausgängen kein einziges interaktives Element enthalten. Das tut er zwar auf Wunsch im Laufschritt, dennoch erfordert es viel Geduld, immer wieder von A über B und C nach A zu laufen. Türen werden vor dem Szenenwechsel brav aufgestoßen und Treppen ein paar Stufen hinaufgetrabt. Natürlich versorgen die vielen Kamerawinkel und Türenanimationen das eigentlich recht begrenzte Areal mit Glaubwürdigkeit, Spaß macht das ewige Hin- und Hergerenne aber nicht.
Grund für die vielen Laufwege sind im Wesentlichen Dialoge. Die zehn Verdächtigen lassen sich zu großen Teilen des Inventars, der gesammelten Dokumente und Spuren und zu wichtigen Aussagen von anderen Verdächtigen befragen. So hat vielleicht Billy eine Information, zu der man Marco befragt, der daraufhin etwas sagt, das Hubert dazu bewegt, Informationen zu verraten, auf die man Billy wieder ansprechen muss. Daher läuft man immer wieder alle Figuren ab, während man auf dem Weg darauf achtet, ob irgendwo noch einer der wenigen Hotspots in der Umgebung auf seine Entdeckung wartet. Ist man damit einmal durch, fängt man wieder von vorne an.
Spricht Jack jemanden an, mit dem er eigentlich gar nichts zu diskutieren hat, vergehen trotzdem einige Sekunden in einem nicht abbrechbaren, immer gleichen Dialog. Das nervt besonders dann, wenn es nicht ein fehlender Dialog ist, der das Weiterkommen verhindert, sondern irgendwo ein Objekt übersehen wurde. Die Gespräche selbst laufen in einem speziellen Modus ab, in dem man abwechselnd die beiden Beteiligten Figuren in Großaufnahme sieht. Am unteren Bildschirmrand sind dann die möglichen Gesprächsthemen sortiert nach Typ aufgelistet. In diesem Modus lassen sich einzelne Zeilen auch abbrechen. Die 3D-Modelle der Personen sind zwar gut ausgearbeitet, schwächeln aber bei der Mimik. Die Gesichtsmuskeln bleiben in der Regel steif und die Lippensynchronität ist eher durchwachsen. Besser funktioniert da schon die Körpersprache, geschmeidigere und zahlreichere Animationen hätten hier aber auch gut getan.
Die Hotspots sind nie wirklich klein, oft allerdings subtil im Hintergrund versteckt. In Kombination mit einer Spielwelt, die zwar nicht groß, dafür aber reich an Szenengrafiken ist, sorgt das immer wieder dafür, dass interaktive Stellen erst beim zehnten Vorbeigehen entdeckt werden. Da will man schon fast von Glück reden, dass es nur so wenige davon gibt.
Leider bedeutet das auch, dass es nur wenige Rätsel gibt - und die sind auch noch sehr leicht. Zwar steckt sich Jack hier und da auch mal was in die Tasche, wie die Objekte eingesetzt werden, versteht sich nach dem Fund des entsprechenden Einsatzortes aber meist von selbst. In Sinking Island stellen sich zu knifflige Rätsel jedenfalls nicht in den Weg der Geschichte.
Der Freund und Helfer der Polizei
Gut gelungen ist der Personal Police Assistant (PPA). Den trägt der Spieler ständig mit sich herum und anders als im spärlichen Inventar ist hier auch tatsächlich etwas los. Dort sammelt das Spiel nämlich automatisch alle Hinweise, auf die Jack Norm im Lauf seiner Ermittlungen stößt. Dazu zählen Fotos, Fingerabdrücke, Fußspuren, etliche Dokumente und Aussagen der Zeugen, die möglicherweise von Bedeutung sind. Ein Vergleichswerkzeug erlaubt es, Spuren - beispielsweise ein Foto von Fußabdrücken im Sand und ein Foto von einer Schuhsohle - zu kombinieren und so weitere Schlüsse zu ziehen.
Dreh- und Angelpunkt des Spielverlaufs sind zwölf Fragen, die nach und nach im PPA auftauchen und die Jack Norm immer näher an die Lösung des Falls heranbringen. Darunter fallen zunächst naheliegende Aspekte wie die Frage, ob es überhaupt ein Mord war oder wer am Tatort war. Jede Frage wird mit einer festen Zahl an Aussagen, Fotos, Abdrücken, Dokumenten und Beweisstücken beantwortet, die per Drag & Drop in die entsprechenden Felder gezogen werden müssen.
Ist eine Frage richtig beantwortet, stellt sich dafür eine neue. Das Prinzip, das es zum Beispiel bei Frogwares in ähnlicher Form gibt, ist sehr gut umgesetzt. Bis auf zwei etwas kniffligere Ausnahmen sind diese Tests logisch zu lösen und damit kein Frustfaktor. Sie sorgen dafür, dass die komplexe Handlung den Spieler nicht abhängt. Fairerweise wird auch angezeigt, ob bereits alle nötigen Hinweise für die nächste Frage gesammelt wurden.
Nebenbei führt der PPA noch eine ständig aktualisierte Liste aller Verdächtigen fort, in der Informationen zu den Figuren wie mögliche Mordmotive verzeichnet sind. Außerdem lässt sich dort ablesen, wo die Personen sich gerade befinden, das ändert sich nämlich immer mal wieder. Insgesamt ist der PPA ein gut umgesetztes Feature und das Highlight des schwachen Spieldesigns.
Spiel auf Zeit
Einen zusätzlichen Aspekt bringt der Zeitmodus ein, den man als Alternative zum Abenteurer-Modus beim Start eines neuen Spiels auswählen kann. In diesem Modus läuft eine Uhr mit und Jack Norm steht plötzlich unter Zeitdruck. Am Nachmittag des ersten Tages steigt beispielsweise der Meeresspiegel. Wenn bis dahin nicht alles in den Außenszenen erledigt wurde, gibt es ein Game Over. Das gibt es unter Umständen auch schon früher, nämlich dann, wenn das Spiel die Lage für aussichtslos hält.
Man ist dann auf einen früheren Spielstand oder ein gelegentlich angelegtes Autosave angewiesen. Unter Umständen muss man also einige Aktionen noch mal ausführen. Wer sich gerne von einem Adventure unter Druck setzen lässt und auf dem Weg zum Ziel Game-Over-Meldungen sammeln möchte, der wird den neuen Modus begrüßen, wirklich passen will die "Innovation" zum Adventure-Genre aber nicht.
Schicke Verpackung
Grafisch liefert White Birds wieder sehr gute Arbeit ab. Besonders die Hintergründe können mit ihrer stilsicheren Optik begeistern. Das Monströse des Turms wird mit viel Gefühl und jeder Menge Liebe zum Detail eingefangen. Überall in dem Gebäude hängen individuelle Kunstwerke. Die vielen Muster in Wänden und Böden folgen einer klaren Linie, welche offenbar der starken künstlerischen Leitung zu verdanken ist.
Die Belebung der Schauplätze ist deutlich besser gelungen als in dem noch etwas steifen Paradise. In den relativ wenigen Außenbereichen tobt ein heftiger Sturm, der sich nicht nur in starkem Niederschlag äußert, sondern auch darin, dass praktisch alle Bäume hin- und hergeschüttelt werden. Auch Wolken und Meer toben durch's Bild, sodass es praktisch keine toten Flecken auf dem Monitor gibt.
Sogar in den Innenräumen, die in ihrer starren und geradlinigen Gestalt eigentlich wenig Potenzial für Bewegung bergen, steckt eine Menge Leben. Hier sind es feine, vom Licht bestrahlte Staubpartikel, die langsam durch die Luft schweben, da ist es ein subtiles Luftflimmern vor den Lampen. White Birds schafft es sehr gut, seinen Schauplätzen die ungelenke Diashow-Ästhetik von gerenderten Standbildern zu nehmen.
Die 3D-Charaktere, die in Paradise noch oft deplatziert wirkten, sind jetzt deutlich besser gelungen. Nicht nur, dass die Modelle selbst hübsch anzuschauen sind, sie fügen sich dank passender Beleuchtung und realistischem Schattenwurf auch gut in die Umgebung ein. Nur ihre Bewegungen wirken manchmal etwas steif. Das Spiel läuft fest in einer Auflösung von 1024x768 Pixeln. Auf schwachen PCs lassen sich visuelle Gimmicks wie Antialiasing, Schatten, Regen oder Animationen abschalten.
Musikalisch bleibt Sinking Island unauffällig, weiß aber trotzdem zu gefallen. Die Musik spielt, wenn sie denn überhaupt zu hören ist, sehr zurückhaltend im Hintergrund und macht oft den atmosphärischen Umgebungsgeräuschen Platz. In Schlüsselszenen könnte eine aktivere Akustik noch stärkere Akzente setzen, man fühlt sich jedoch nie von ihr im Stich gelassen. Gelungen, wenn auch unspektakulär, ist die Vertonung der Dialoge. Alle Sprecher liefern professionelle Arbeit ab.
Story hui, Spiel pfui
Sinking Island hinterlässt einen sehr zwiespältigen Eindruck. Auf der einen Seite steht eine eigentlich hochspannend konstruierte Geschichte mit einer Reihe interessanter Charaktere. Dazu kommt eine handwerklich saubere Umsetzung, die gerade nach dem schwachen Debüt-Adventure des Entwicklers versöhnlich stimmt.
Auf der anderen Seite steht die bittere Erkenntnis, dass das Spiel nicht wirklich Spiel ist. Was den Spieler beschäftigt ist nicht das Erknobeln von Rätsellösungen, sondern zum großen Teil das wiederholte Ablaufen aller Locations auf der Suche nach dem übersehenen Hotspot. Das Herumlaufen und das Absuchen des Bildschirms machen viel zu große Teile aus und beschädigen die tolle Grundidee.
Michel Bams hat kürzlich bemerkt: "Als Benoît mit der Arbeit an Amerzone angefangen hat, wollte er nicht wirklich ein Spiel machen." Mit dieser Einstellung ist man offenbar auch an das erste Jack-Norm-Abenteuer herangegangen. Vielleicht wäre dann aber ein Film oder ein Comic ein geeigneteres Mittel gewesen, um diese Geschichte zu erzählen.
Dennoch: Wer genug Zeit und Geduld mitbringt und auf knifflige Rätsel ohnehin verzichten kann, der erlebt mit Sinking Island ein klassisches Whodunnit, das mit der lieb gewonnen Sokal-Ästhetik durchwirkt ist und die mit Traditions-Marken wie Sherlock Holmes oder Agatha Christie verzierte Adventure-Konkurrenz nicht fürchten muss.
Kommentar des Verfassers
Kommentare

Was für eine tolle Geschichte! Für mich ist der Fall, den White Birds hier zusammengestrickt hat, noch spannender und interessanter als im Agatha-Christie-Adventure Und dann gabs keines mehr. Nur wo da der Inventar-Overkill von der eigentlichen Geschichte abgelenkt hat, fehlt hier quasi völlig ein Spiel.
Womit habe ich beim Spielen meines Zeit verbracht? Im Wesentlichen mit rumlaufen, Hotspots suchen und Dialoge durchklicken. Die ersten beiden Punkte sind öde, der dritte zwar spannend, aber spielerisch nicht wirklich anspruchsvoll. Rätsel waren praktisch immer in dem Moment gelöst, als die entsprechenden Hotspots gefunden waren. Einziger Lichtblick war für mich der PPA.
Redaktions-Wertung





Gesamt
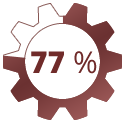
- Hervorragende Geschichte
- Sehr stilsicher
- Schicke Optik
- Belebte Umgebungen
- Zu viel laufen
- Zu viel suchen
- So gut wie keine Rätsel
- Recht träge
Aktuelle Artikel
![]()
Unterstützen
![]()
Adventure-Treff-Verein
IBAN: DE38 8306 5408 0004 7212 25
BIC: GENODEF1SLR
Bitte beachtet, dass wir leider keine steuerrechtlich anrechenbare Spendenquittungen ausstellen können.
Mit jedem Einkauf bei unseren Partnern unterstützt ihr die Arbeit des Adventure-Treff e.V.












